Der digitale “Krimi”
von Winfried Dunkel
Auf der High
End 2001 kam ein freundlicher Herr in unser Ausstellungszimmer. Nach entsprechenden
Darlegungen zeigte er mir eine kleine, weiße Kunststoffscheibe, die man
auf die abzuspielende CD legt. Nun bin ich, wie wohl allen Lesern bekannt
ist, absolut kein Freund von Tuningmaßnahmen. Doch die Argumente, die
Herr Clemens vorbrachte, wirkten logisch und schlüssig, weshalb ich mich
bereit erklärte, das Scheibchen nach der Messe in meinem Studio auszuprobieren;
nicht zuletzt, weil der Endverbraucherpreis (35.-DM) sich wirklich moderat
zeigt.
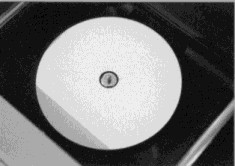 Hätte
ich seinerzeit geahnt, was da auf mich zukommen würde, welchen Erdrutsch
ich da miterleben und -gestalten sollte - ich wäre vermutlich ausgewandert
... Fidschi-Inseln, oder so.
Hätte
ich seinerzeit geahnt, was da auf mich zukommen würde, welchen Erdrutsch
ich da miterleben und -gestalten sollte - ich wäre vermutlich ausgewandert
... Fidschi-Inseln, oder so.
Ouvertüre
Wie oft ich seit Beginn der Erprobung des White Mirror, so heißt die CD-große,
dünne weiße Scheibe aus speziellem Kunststoff, die Gardinen in meinem
Tonstudio betrachtet habe, kann ich gar nicht mehr zählen. Sie haben jetzt
ein Fragezeichen im Kopf? Nun, die Sache ist folgende: Die Aluminiumbeschichtung
der meisten CDs ist so hauchdünn, daß man mühelos hindurchsehen kann,
hält man sie vor einen hellen Punkt im Raum - nämlich das Fenster. Routinemäßig
wurde seit Inbetriebnahme des White Mirror bei jeder CD der “Durchblick-Test”
gemacht ... wie gesagt, Gardinenbesichtigung. Ferner sollten Sie diverse
CDs mal vor eine Lichtquelle (z.B. Schreibtischlampe) halten, dann sehen
Sie buchstäblich Sternchen - das sind die Löcher in der ohnehin dünnen
Aluschicht.
Genau hier setzte Herr Clemens den gedanklichen Hebel an: Wenn die CD
durch Auflegen des White Mirror undurchsichtig wird, müßte theoretisch
der Abtastvorgang verbessert werden. Das Laserlicht kann nicht mehr “durchschießen”,
an winzigen Beschichtungslöchern wird durch Reflexion (weiße Auflage)
die digitale “1” erzeugt, was der Korrekturschaltung in Worterkennung
und “Reparatur” zugute kommen sollte. Die weiße Farbe kristallisierte
sich im Laufe seiner Versuche als die klanglich günstigste heraus. Das
gilt ebenso für die leichte, präzise Aufrauhung (20µ) jener Seite des
White Mirror, welche auf das Label der CD gelegt wird. Insgesamt gingen
des Entwicklers Gedanken auch in Richtung “reduziertes Streulicht” und
“Wegfall der lichttechnischen Modulationen als Folge teildurchsichtiger
Label-Lackierungen”.
Das alles leuchtet ein, weshalb ich - wie gesagt - den White Mirror ausgiebig
untersuchte.
Ergebnisse
Daß gravierende Veränderungen im Klangbild nicht vorkommen würden, war
von Anfang an klar, daher hielt ich es für sinnvoll, mit sensibler Musik
zu beginnen: Alte Musik, diese so fragilen, feinstverästelten Klänge,
erzeugt von äußerst empfindlich reagierendem Instrumentarium. Bleibt die
Wiedergabekette nicht völlig neutral und zeitrichtig “am Ball”, werden
beispielsweise akustische Unterschiede zwischen Rankett und Bombarde,
Portativ und Regal, Virginal und Spinett, die mitunter (Bauart, Spielweise)
recht gering sind - trotz gravierend abweichender Bauformen -, nivelliert
bis hin zu einer Größenordnung, daß auch der kundige Hörer nicht mehr
sagen kann, was Sache ist. Sehr diffizil zeigt sich das Psalterium - macht
die Wiedergabekette etwas falsch, kann der Eindruck entstehen, es ertöne
eine Cister (bzw. Citole). Die Beispiele ließen sich fortführen, doch
möge das Gesagte hinreichen. Fakt ist: Alte Musik zeigt in hervorragender
Weise Können und Nichtkönnen von Geräten auf - und natürlich von Zubehör!
CD einlegen, White Mirror darauf, Schublade läuft in Betriebsstellung
... das seit Jahren gewohnte, etwas rabiate Schließgeräusch erscheint
bedämpft ... wär’ mir das doch bloß nicht aufgefallen: Folgen siehe weiter
unten. Es erklingt Musik der Spielleute von der CD “Troubadours” (Teldec
8.44015), die aufgrund ihrer Sensibilität allerhöchste Anforderungen stellt.
Ich zitiere einfach meine Hörnotizen: “Zupfinstrumente etwas besser positioniert;
minimaler, doch deutlicher Zugewinn an Umrißzeichnung; Glöckchen etwas
präziser (Ein- und Ausschwingvorgänge deutlicher); Basisbreite scheint
eine Winzigkeit weiter ausgedehnt. - Ohne White Mirror: Laute ‘fasert’
etwas nach links, Fidel etwas schärfer.”
Zu den aussagefähigsten “Test-CDs” zählt immer noch “Villancicos” (HMF
190 1025). Im für hörmäßige Untersuchungen optimal geeigneten Titel 3
(Index 4) scheint White Mirror die Theorien von der verbesserten Datenauslese
rückhaltlos zu bestätigen: Die Schnurrpfeife gerät exakter durchgezeichnet,
Glöckchen kommen prägnanter, die Vasentrommel Tombak gewinnt an Druck
und Fülle bei gleichzeitig besserer Ortbarkeit, der Raum erscheint insgesamt
“stabiler”, glaubhafter, anfaßbarer mithin. In der Summe würde ich, um
Ihnen eine Vorstellung von der Größenordnung des Verbesserungspotentials
zu geben, sagen wollen: Eine Steigerung des klanglichen Erlebens um ca.
1%. Das ist wenig, gleichzeitig aber auch viel, wenn man bedenkt, daß
gerade jene Details gewinnen, die für den natürlichen Habitus der Musik
verantwortlich sind. Auf schwer beschreibbare Weise gewinnt die Reproduktion
an Fluß und Ruhe - nicht plakativ, sondern subtil.
Die mittels White Mirror erreichbaren Verbesserungen zeigten sich von
CD zu CD unterschiedlich. Bei einigen tat sich überhaupt nichts, andere
wieder legten doch recht deutlich zu - bleiben wir bei den an sich unzulässigen
Prozentangaben (die ich unbedingt subjektiv verstanden wissen möchte!),
ergibt sich ein Schwankungsfaktor von 0 bis 2% als Mittelwert. Besonders
positiv wirkte White Mirror bei der CD “Populäre französische und englische
Tänze des 16. und 17. Jahrhunderts” - der Titel steht auf HMF 901152 natürlich
in französischer Sprache. Im Titel 12 (“The spanish gipsy”, aus der Sammlung
von John Playford) erbringt die Verwendung des White Mirror fürwahr erstaunliche
Verbesserungen, welche allesamt in Richtung deutlichere, präzisere Durchzeichnung
und gesteigerte Perkussivität zielen. Der “Rückwärtstest”, also Abhören
ohne White Mirror, gerät dann besonders auffällig, weil absteigende Qualität
stärker empfunden wird als aufsteigende.
Natürlich habe ich nicht nur Alte Musik gehört. Die kurz dargestellten
Ergebnisse lassen sich jedoch weitgehend auf alle von mir bevorzugten
Musikarten übertragen, mit mehr oder weniger vergleichbaren Ergebnissen.
Daß sie bei Alter Musik am deutlichsten sein müssen, habe ich eingangs
begründet.
Damit könnte ich jetzt das “Fazit” formulieren, wäre nicht jener Erdrutsch
in Bewegung geraten, von dem ich zu Beginn sprach...
Des Krimis
erster Teil
Fatalerweise ist Herr Werner Clemens, der Entwickler des White Mirror,
ein gewissenhafter und ehrlicher Mensch. “Ich kann meinen Kunden nicht
irgendwelche Halbheiten und Vermutungen verkaufen, daher lasse ich jetzt
die Sache meßtechnisch überprüfen.” Das geschah dann auch...
Im Meßlabor eines großen CD-Herstellers (dessen Name außen vor bleiben
soll), mit Equipment im Gegenwert mindestens eines Einfamilienhauses,
wurde White Mirror in aufwendigsten Messungen in 35 Parametern untersucht.
Ergebnis: Null und Nichts!!! Soll heißen: Ob mit oder ohne White Mirror
- der Datenstrom blieb bei allen Messungen unverändert! 370 Fehler pro
Sekunde - damit ist die Korrekturschaltung gerade mal zu 2% ausgelastet;
zwar steigt das exponentiell, doch selbst 900 Fehler pro Sekunde werden
noch mühelos, ohne Datenstromveränderung, eliminiert. Damit brach Herrn
Clemens’ (und meine) Theorie, White Mirror würde die Datenauslese verbessern
und dadurch die zweifelsfrei hörbare klangliche Steigerung ermöglichen,
wie das vielzitierte Kartenhaus in sich zusammen. So dumm habe ich wohl
noch nie aus der Wäsche geschaut ... sind wir womöglich dem sog. Placebo-Effekt
auf den Leim gegangen?
Alle Hörversuche habe ich ergo in den folgenden Tagen wiederholt - mit
exakt den gleichen Ergebnissen! Ja, eindeutig: Es passiert was, White
Mirror kann bei den allermeisten CDs die Wiedergabe in der vorbeschriebenen
Art und Weise verbessern. Aber wie ... zum Teufel, aber wie!?
Des Krimis
zweiter Teil
Jetzt hieß es, kühlen Kopf bewahren und schrittweise vorgehen, sich nicht
als Folge einer Synkatathesis zu verrennen, mental zu blockieren. Also
las ich alles, was bei mir an Fachliteratur zum Thema “Laser” und “CD-Entwicklung”
vorliegt, respektive alles, was sich ausleihen ließ; Telefongespräche
mit Dipl.-Phys. Fred-Michael Bülow brachten weitere Kenntniszuwächse.
Betrachten wir in Stichworten die Fakten:
Grundlage des Lasers ist die “induzierte Emission”, deren theoretische
Basen von Albert Einstein 1916 bezugnehmend auf den “Maser” (Micro-wave
amplification) erkannt wurden (durch Mikrowellen der Frequenz 24 GHz erregte
Signalverstärkung im reaktiven Rubin);
der mit Licht induzierte Laser war bis 1959 rein spekulativ; Arthur Schawlow
und Charles Garret arbeiteten seit 1953 am lichtinduzierten Maser mit
einem Reaktionselement aus Kaliumdampf, aus dem 1955 der heute nur noch
akademisch interessante Caesium-Laser entstand;
Schawlow, der Mitarbeiter der Bell Telephone (USA) war, schlug rote Rubine
mit hohem Chromgehalt vor und gelangte zur Theorie des Infrarot-Lasers,
erlag dann aber dem Irrtum, dessen Phosphoreszenz sei ungeeignet;
Theodore Maiman erkannte die grundlegende Wichtigkeit der Anregung der
im Rubin vorhandenen Chromionen sowie die Tatsache, daß für eine Lasertätigkeit
mehr als 50% dieser Ionen angeregt werden müssen;
Hermann Statz und George de Mars (Radarfirma Raytheon, USA) erarbeiteten
die erforderlichen Gleichungssysteme;
Maiman arbeitete intensiv am Kristall-Laser, auf Basis der Erkenntnisse
von Schawlow, die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte Maiman
am 22.4.1960 in der amerikanischen Fachzeitschrift “Physical Review Letters”;
erster Laser-Versuchsaufbau bei Bell Telephone auf Basis von Maimans Forschungen
durch Robert Collins, Donald Nelson, Walter Bond, Charles Garret und Werner
Kaiser: optisch hochpräziser Rubinwürfel, verspiegelt, mit definierter
Austrittöffnung für das kohärente Licht, optische Induktion durch Xenon-Blitzlampe,
sukzessive Energieerhöhung der Blitzlampe zündete im August 1960 den ersten
Rotlichtlaser;
anläßlich einer Pressevorführung entdeckte man am 14.12.1960 zufällig
die Modulationsfähigkeit des Lasers durch Schallwellen: ein ergriffener
Besucher sagte beim Anblick des Laserstrahls: “There!” - und der Laser
vibrierte im Takt der Stimmfrequenz.
Modulation durch Schallwellen ... durch Schallwellen ... mit White Mirror
reduziert sich das Schließgeräusch meiner Player-Schublade ... Schallwellen!
Doch Vorsicht: Nicht blockieren, es gibt noch andere zweifelsfrei nachgewiesene
Einflußgrößen, auf die ein Laser reagiert: Neben den schon genannten Schallwellen
sind dies Magnetismus und elektrische Felder; beide sollten daher ebenfalls
tunlichst vom Laser ferngehalten werden! Betrachten wir kurz die Zusammenhänge:
Der im “continous run modus” arbeitende Laser im CD-Player (Rotlichtlaser,
Wellenlänge 700 nm) ist auf die “pits” der CD scharfgestellt, d.h., die
pits haben eine Hohlspiegelfunktion. Das von den Hohlspiegeln in die Photodiode
reflektierte Licht ist stärker als das von der glatten Fläche zurückgelenkte.
Daher bildet der pit die Eins, die glatte Fläche die Null. Lichtoptische
Einflüsse stören folglich nicht den Laser selbst, sondern den Informationsempfang
der Photodiode. Dieser kann im wesentlichen beeinflußt werden durch: 1)
axiale und/oder radiale Exzentrizität der CD (eventuell komplizierte Nachsteuervorgänge),
2) Unwucht im Tonträger (möglicherweise wird die Drehzahlregulierung belastet),
3) Streulicht (reaktive Vorgänge in der Photodiode).
Die Punkte 1) und 2) haben allenfalls peripher mit der Datenauswertung
zu tun - die Korrekturschaltungen sind extrem leistungsfähig, weshalb
Auslesefehler im Sekundenbruchteilbereich (und mehr wird es ja nicht)
kaum als Ursache für klangliche Veränderungen angesehen werden dürften.
Logischer könnte diese Erklärung sein: Kurzzeitige, ggf. intervallartige
Nachsteuervorgänge der Abtastkinematik (hier: Fokusmotor, Spurmotor) fordern
Stromspitzen ab, die vom Netzteil schlagartig bereitgestellt werden müssen,
bei einfachen Netzteilen also zu kurzzeitigen Spannungsschwankungen führen,
besonders, wenn lediglich ein sparsam ausgelegtes Netzteil sämtliche Baugruppen
des Players versorgen muß. Daß Spannungsschwankungen auf die Analogsektion
negative Auswirkungen haben, bedarf gewiß keiner besonderen Darstellung,
zudem liegen hier entsprechende Messungen von Dipl.-Phys. Bülow vor, die
genau diese Beeinträchtigungen nachweisen. Damit bietet sich das erste
Erklärungsmuster für Klangverbesserungen durch Beruhigung der Abtastkinematik
an. Auf der digitalen Seite dagegen dürften die Spannungsschwankungen
kaum Einfluß nehmen - wie wir vorgängig gesehen haben, erweisen sich Auslesung
und Korrektur als äußerst “robust”, soll heißen: störresistent.
Inwieweit schwergewichtige Auflagen oder Pucks, wofern sie nicht vom Hersteller
konstruktiv eingeplant sind, die Wiedergabe beeinträchtigen, müßte noch
eruiert werden. So schön z.B. eine dicke, weiche und schwere Auflage zu
akustischer und damit letzten Endes auch mechanischer Beruhigung (der
Abtastkinematik) beiträgt - das Gewicht stellt leider einen weiteren Knackpunkt
dar. Lassen wir die mechanische Belastung der Motorlager außer Acht, sondern
bedenken nur die mögliche Störung der Drehzahlsteuerung: Die CD wird von
innen nach außen abgetastet, dabei muß ihre Drehzahl von (innen) 550 U/min
je Spurzeile heruntergesetzt werden, bis sie schließlich auf 200 U/min
(außen) abgefallen ist. Diese Brems/Regelvorgänge mit Gewichten zu erschweren
und evtl. zu verlangsamen, bedeutet nichts anderes, als abermals Störeinflüsse
auf die Abtastkinematik zu generieren. Sie sollten deshalb vor Verwendung
solch schwergewichtiger Auflagen unbedingt den Rat des Player-Herstellers
einholen - und befolgen.
Versuchsaufbau
Wieso zeigte sich bei der HMF-CD 901152 im Titel 12 ein erheblich größeres
Verbesserungspotential als bei allen anderen? Die von Tonmeister Pontefract
aufgenommene CD dokumentiert seine typische Handschrift: Das gegebene
Gesamtensemble ist optimal im Aufnahmeraum verteilt und positioniert.
Wenn es vorkommt, daß nur ein Teil des Ensembles agiert, stellt Pontefract
die Musiker nicht um, damit die Ganzheitlichkeit gewahrt bleibt. Das bedeutet:
Im take 12, “The spanish gipsy”, erklingt links eine Fidel (weil sie dort
immer steht), im rechten Kanal dagegen sorgen Schnurtrommel, Flöte und
zweite Fidel für ganz schön “power” auf dem Punkt.
Nun steht in meinem Studio der CD-Player rechts, im indirekten Schallfeld
des rechten Monitors, wird mithin recht beträchtlichen Schallwellenanteilen
ausgesetzt. Schlußfolgerung: Da White Mirror ganz offensichtlich für eine
akustische (resultierend: mechanische) Beruhigung sorgt, erklärt sich
daraus ansatzweise die bei diesem Titel zu hörende, beachtliche Klangverbesserung.
Auf dieser ersten greifbaren Erkenntnis basierte der Versuchsaufbau, bei
dessen Installation ich unterschwellig von dem Gedanken an diese Hütte
auf den Fidschi-Inseln begleitet wurde...
Da mein Player trafosymmetrische Ausgänge besitzt, verband ich ihn über
zwei (l/r) je acht Meter lange Kabel mit den Eingängen 7 und 8 meines
Mischpultes (elektronisch-symmetrische Normeingänge). Nein, diese acht
Meter Leitungslänge sind bei Ein- und Ausgängen nach IRT 3/5 absolut nicht
qualitätsmindernd! (Nebenbei bemerkt: In der Studiotechnik sind Kabelkapazitäten
usw. dank (u.a.) leistungsfähiger Treiberstufen kein Thema. Und elektrischer
Strom “fließt” bekanntlich mit Lichtgeschwindigkeit, das sind 299.792,5
Kilometer pro Sekunde - da ist es ganz Wurst, ob die Leitung zwei oder
50 Meter Länge mißt...) Zwei ausreichend lange, abgeschirmte Netzkabel
mit zwischengeschaltetem Netzfilter (WBE “Strainer 3”) verbanden CD-Player
und Steckdose.
Ich hörte mich auf diese Konfiguration ein, was nicht für die Kabel, sondern
nur für die Tatsache galt, daß ich den folgenden Versuch ohne meinen sonst
stets verwendeten externen D/A-Wandler durchführen mußte, denn zwei Geräte
hätten den geplanten Test “logistisch” erschwert. Was ich gemacht habe?
Nun, einfach folgendes:
Alle weiter oben genannten CDs hörte ich intensiv ab, genauer gesagt,
die aussagefähigsten Stücke. Mit White Mirror und ohne, ohne und mit.
Positiv- wie Negativauffälligkeit wurden akribisch notiert. Wiederum erwies
sich Titel 12 auf der HMF-CD als der reaktivste: Mit White Mirror ergab
sich deutlich verbessertes klangliches Erleben, so, wie bereits dargestellt.
Dann wurde es ernst: Ich stellte den CD-Player nun nach draußen (daher
die langen Kabel), neben die schallisolierte Türe meines Studios; damit
konnten ihn Schallereignisse nicht mehr erreichen. Sitzen Sie gut? Draußen,
außerhalb des Schallfeldes, ergab sich absolut kein Unterschied mehr,
gleichgültig, ob mit oder ohne White Mirror! Selbstredend habe ich diesen
Versuch dreimal durchgeführt - stets mit völlig identischen Ergebnissen:
Im Studio (Schallwelleneinfluß) erbrachte White Mirror die beschriebenen
Verbesserungen, draußen (ohne Schallwelleneinfluß) waren die Divergenzen
restlos verschwunden. Damit dürfte die These, daß klangliche Verbesserungen
tatsächlich durch akustische, in der Folge mechanische Beruhigung der
Abtastkinematik herbeigeführt werden, zumindest vorläufig belegt sein.
Des Krimis
dritter Teil
Herr Clemens gab die gewonnenen Erkenntnisse an einen Bekannten weiter,
der meine strapaziöse Versuchsreihe nachvollzog. Rückmeldung: “Dunkel
hat recht, funktioniert!”. Ein Leser, dem ich, anläßlich seines Telefonates
mit mir, von der Geschichte erzählte, probierte eine andere Methode: Er
stülpte die Schallschutzhaube eines Nadeldruckers über den Player - das
Ergebnis entsprach dem meinigen. Ad acta mit der Sache? Von wegen!
Werner Clemens ließ der “Krimi” verständlicherweise keine Ruhe und so
probierte er seinen White Mirror in einem Laufwerk mit “Disc-Clamp-System”
aus. Eigentlich dürfte hier nichts mehr “passieren”, da Disc-Clamp die
CD in vollem Umfang festklemmt und damit ruhigstellt, durch seine Dämpfungsfunktion
(Masse) folglich auch positiv auf die Abtastkinematik einwirkt. Ich schreibe
es ungern ... wieder traten Unterschiede auf, wenn mal mit, mal ohne White
Mirror gehört wurde! Ich würde nun zum Probabilismus neigen, gäbe es nicht
noch zwei denkbare Einflußgrößen: die Wirbelströme und den Kerr-Effekt.
1) Wirbelströme
Zitat aus Blatzheim: “Fachkunde für Elektriker”, Ausgabe 1962:
(Abgebildet ist ein Pendel, das zwischen den Polen eines Elektromagneten
schwingt.) “In Bild 79 ist ein Pendel an seinem unteren Ende mit einer
Aluminiumplatte versehen (es könnte auch ein anderes unmagnetisches Metall
sein). Es schwingt zwischen den Polen eines Elektromagneten. Wird beim
Schwingen des Pendels der Strom in den Magnetspulen eingeschaltet, dann
kommt das Pendel augenblicklich zur Ruhe.
Die Erklärung für diese Erscheinung ergibt sich aus folgender Überlegung:
Sobald die Aluminiumplatte beim Schwingen zwischen die Pole kommt, schneidet
sie magnetische Feldlinien. Dadurch werden in der Aluminiumplatte Ströme
induziert. (...) Sie verlaufen bei der Pendelbewegung von rechts nach
links in dem betrachteten Augenblick im linken Teil der Platte von unten
nach oben. Sie schließen sich über den rechten Teil der Platte. Ihre Bahn
ist wirbelförmig. Sie werden infolgedessen ‘Wirbelströme’ genannt. (...)
Die induzierten Wirbelströme haben ein Magnetfeld zur Folge, das so gerichtet
ist, daß es im Zusammenwirken mit dem Feld des Elektromagneten das Pendel
abbremst. (...) Wirbelströme entstehen auch in jedem ruhenden Leiter bei
magnetischen Flußänderungen, also immer dann, wenn sich die Zahl der magnetischen
Feldlinien, die den Leiter durchsetzen, ändert. (...)” Zitat Ende.
Wirbelströme im ruhenden Leiter - das ist für unsere CD-Betrachtung ohne
Belang, doch bieten sie Denkstoff für Kabelfreaks ... ganz sadistisch:
Warum soll es denen besser gehen als mir?
Zurück zu den im Aluminium induzierten Wirbelströmen und ihren Magnetfeldern:
Hören Sie jetzt auch “die Nachtigall trappsen”?
Dröseln wir’s mal auf: Der Antriebsmotor des Players ist in aller Regel
ein hallkommutierter Gleichstrom-Nebenschlußmotor. Gleichgültig, ob das
Statorfeld durch Wicklungen oder Dauermagnete gebildet wird: hier existieren
starke Magnetfelder. Sollten diese nicht völlig abgeschirmt sein, ist
es denkbar, daß magnetische Feldlinien die rotierende CD erreichen - und
in ihr Wirbelströme (in der Aluminiumbeschichtung) erzeugt werden. Das
daraus resultierende Bremsmoment ist vermutlich belanglos (jedoch: erhöhte
Ströme, Netzteilbelastung?), betrachtenswert aber scheinen unbedingt die
induzierten magnetischen Felder, welche auf den Laser einwirken. Doch
da wir mittlerweile wissen, daß die Datenauslesung in Kommunikation mit
der Fehlerkorrektur ein recht unerschütterliches System ist, dürften geringfügige
Ablenkungen (so sie überhaupt entstehen) nicht das Thema sein, vielmehr
neuerlich die eventuelle zusätzliche Regelarbeit der Abtastkinematik -
wobei wir schon wieder bei den Stromspitzen und ihrer Rückwirkung auf
die Analogsektion wären...
2) Kerr-Effekt
Zitat aus “Neues Universal-Lexikon Band 2”, Lingen, 1979:
“Bezeichnung für den elektrooptischen Effekt der Doppelbrechung des Lichts
beim Durchgang durch besondere, aus polarisierten Molekülen, z.B. Nitrobenzol,
bestehende Flüssigkeiten im elektrischen Feld (nach dem englischen Physiker
und Theologen John Kerr, 1824 - 1907), benannt.” Zitat Ende.
Kann dieser Effekt u.U. auch bei der CD auftreten? Erklärt er womöglich
die sonst nicht manifestierbaren Auswirkungen von Anphasen, Kantenfärbungen
und so weiter? Hier bitte ich die Physik, zu übernehmen...
Fazit: Wie eingangs gesagt: Hätte ich gewußt, was dieses unschuldig
aussehende, weiße Kunststoffscheibchen namens White Mirror auslösen würde
... Fidschi-Inseln, oder so. Bislang physikalisch nicht restlos erklärbar
ist die Tatsache, daß dieses zwei Gramm leichte Teil wirklich klangliche
Verbesserungen erbringt - in unterschiedlichen Größenordnungen, von CD
zu CD verschieden. Es steigert für wenig Geld den Spaß am Musikhören;
und das sollte uns vorläufig genügen. Dennoch scheint es ratsam, einmal
Messungen mit beschalltem und unbeschalltem CD-Player durchzuführen. Bis
derartige Ergebnisse vorliegen, höre ich Musik, ohne länger über all die
dargestellten Problemkreise nachzudenken. Denn heute, am Tag der Niederschrift
dieses Manuskriptes, glaube ich, die Beruhigung der Abtastkinematik als
Ursache nennen zu dürfen. Morgen allerdings kann alles wieder ganz anders
sein. Fazit des Fazits: Hören, genießen und (wenigstens vorläufig) vergessen...
WD
Das Produkt:
White Mirror No.1
Preis: 35,00 DM
Herstellung und
Vertrieb: High Fidelity-pur, Werner Clemens Heerstraße 39, D-41452 Dormagen
Tel.: 02133-535520,
Fax: 02133-535522
E-Mail: info@highfidelity-pur.de
Internet: www.highfidelity-pur.de
Gehört
mit:
Raum: Tonstudio mit Akustikausbau (u.a. Helmholtz-Resonatoren,
Tube-Traps etc.),
Hörabstand: direktes Schallfeld, 2m;
Plattenspieler: EMT 948 (ARD-Ausführung), EMT 930st (ARD-Ausführung);
Bandmaschinen: TELEFUNKEN M 15, NAGRA IV-S, REVOX PR 99;
DAT-Recorder: 1) PANASONIC SV-3800; 2) SONY DTC 1000 ES (Submixgruppe);
CD-Player: REVOX C 221 (nur Laufwerk);
A/D-D/A-Wandler: RTW DistriCon modular;
Tuner: KLEIN & HUMMEL FM 2002 (Submixgruppe)
Vorverstärker: prof. Mischpult SONY BROADCAST MX-P 61 (gem. IRT
3/5) mit Gleichstromversorgung;
High-End-Schleife: Vorverstärker TESSENDORF TE 1, Phonovorstufe
(MC) TESSENDORF Phono mit Teflonplatine - beide über TE-Filternetzteil;
Lautsprecher: GEITHAIN RL 903 (aktive Studiomonitore);
Kopfhörer: STAX Lambda pro mit SRM-1 Mk 2 und ED-1 Monitor;
Mikrophone: BEYER M 201 N, NEUMANN KM83i, SENNHEISER MKH 40 P 48
Submixgruppe: Rauschfilter: VCF-System dbx SNR-1, AUX-Verteiler:
AKAI DS-5 (VCF und AUX mit Routingmöglichkeit auf Gesamtequipment), Leitungssymmetrierer:
ENTEC a.b.o.;
Kabel (analog): EMT 2111, BEDEA tfBl, KLOTZ pmc-p;
Kabel (digital): AES-EBU und SPDIF: SOMMER-Cable "binary 234";
Netzfilter: AUDIO AGILE clear 3F, WBE "strainer 3" (3x) / "strainer
10" (2x), AUTH EM 504 (4x); Abgeschirmte Netzkabel: AUDIO AGILE, WBE "Tail
Nr.1", SIEMENS LSYCY;
Zubehör: TESSENDORF CE-Erdungskoppler (3x); Labornetzteil f. Mischpult:
HGL 1210 LBN Kombinierte Sternpunkt- und Flächenerdung; Schallplatten-Naßabtastung