von Winfried Dunkel
In der Ausgabe Nr. 30 unserer Zeitschrift habe ich, ab Seite 7, versucht, in stark verkürzter Form einen Zirkelkreis um die Musik der Welt zu ziehen und dabei der Frage nach ihrer Herkunft, ihren Wurzeln, auf etwas unorthodoxe Art und Weise eine rudimentäre Antwort entgegengesetzt. Zwecks besseren Verständnisses möchte ich - in diesem Heft beginnend - mehrere Tonträger vorstellen. Hierbei wird es abermals im Zick-Zack-Kurs um die Welt und durch die Kulturen gehen. Das mag eventuell etwas chaotisch wirken, doch bitte ich zu bedenken, daß eine “Anthologie der Weltmusik”, wollte man sie thematisch logisch aufbauen, in etwa den Umfang des “Großen Brockhaus” annehmen würde... Beugen wir uns also dem Sachzwang und greifen rund um die Welt und querbeet durch Völker und Kulturen einige bemerkenswerte Schallplatten und CDs heraus, die praktisch jedem Hörer Appetit machen auf mehr. Folgende drei Tonträger bilden die Ouvertüre:
1) INTI ILLIMANI:
“La Nueva Canción Chilena”
EMI Italiana, 3C 054-62161 (LP)
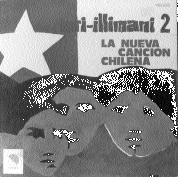 Chile,
gelegen an Südamerikas Westküste, erstreckt sich über rund 4000 Kilometer
Länge und dürfte speziell Gourmets wegen seiner vorzüglichen Rotweine
ein Begriff sein. In letzter Zeit ist das Land mit den Vorgängen um seinen
verflossenen Diktator Pinochet wieder in die Schlagzeilen geraten - was
mich unlängst dazu brachte, eine Schallplatte mit politischen Liedern
der chilenischen Gruppe INTI ILLIMANI auf den Plattenteller zu legen.
Das politische Lied als Vertreter der Sparte “Weltmusik”? Eindeutig ja!
Schließlich werden in ihm kultur- und landesspezifische Vorgänge und ebenfalls
kultur- und landesspezifische Reaktionen auf sie deutlich, die letzten
Endes - als musikalischer Ausdruck - helfen, die Weltmusik zu charakterisieren
und einzuordnen. Der politische Hintergrund der hier vorgestellten Schallplatte
ist eben die Regierungszeit des vorgenannten Diktators; und mit den typischen
Formen andiner wie auch europäischer Musik, bzw. deren gekonnter Synthese,
reiht sich die Gruppe Inti Illimani in die Kreise der folkloristisch basierten
“Nur-Musiker” ebenso ein wie in jene der international anerkannten Liedermacher.
Eine maßstabsetzende Scheibe, die leider nur noch im Second-Hand-Laden
greifbar sein dürfte. Gleichwohl stelle ich sie Ihnen vor, da musikalische,
interpretatorische und tontechnische Spitzenleistung geboten wird und
daher gezielte Suche sinnvoll ist. Vielleicht aber fristet sogar ein Exemplar
ein übersehenes Dasein in Ihrer Schallplattensammlung - Leser meines Jahrganges,
welche, angesichts der Machtübernahme durch die Miltärs in diversen südamerikanischen
Ländern, Protesten aus den Reihen der linksorientierten Intellektuellen
ein offenes Ohr liehen, könnten diese LP durchaus besitzen, denn wie die
Gruppe QUILAPAYUN, wie MERCEDES SOSA, zählte Inti Illimani zur international
anerkannten Elite des politischen Liedes.
Chile,
gelegen an Südamerikas Westküste, erstreckt sich über rund 4000 Kilometer
Länge und dürfte speziell Gourmets wegen seiner vorzüglichen Rotweine
ein Begriff sein. In letzter Zeit ist das Land mit den Vorgängen um seinen
verflossenen Diktator Pinochet wieder in die Schlagzeilen geraten - was
mich unlängst dazu brachte, eine Schallplatte mit politischen Liedern
der chilenischen Gruppe INTI ILLIMANI auf den Plattenteller zu legen.
Das politische Lied als Vertreter der Sparte “Weltmusik”? Eindeutig ja!
Schließlich werden in ihm kultur- und landesspezifische Vorgänge und ebenfalls
kultur- und landesspezifische Reaktionen auf sie deutlich, die letzten
Endes - als musikalischer Ausdruck - helfen, die Weltmusik zu charakterisieren
und einzuordnen. Der politische Hintergrund der hier vorgestellten Schallplatte
ist eben die Regierungszeit des vorgenannten Diktators; und mit den typischen
Formen andiner wie auch europäischer Musik, bzw. deren gekonnter Synthese,
reiht sich die Gruppe Inti Illimani in die Kreise der folkloristisch basierten
“Nur-Musiker” ebenso ein wie in jene der international anerkannten Liedermacher.
Eine maßstabsetzende Scheibe, die leider nur noch im Second-Hand-Laden
greifbar sein dürfte. Gleichwohl stelle ich sie Ihnen vor, da musikalische,
interpretatorische und tontechnische Spitzenleistung geboten wird und
daher gezielte Suche sinnvoll ist. Vielleicht aber fristet sogar ein Exemplar
ein übersehenes Dasein in Ihrer Schallplattensammlung - Leser meines Jahrganges,
welche, angesichts der Machtübernahme durch die Miltärs in diversen südamerikanischen
Ländern, Protesten aus den Reihen der linksorientierten Intellektuellen
ein offenes Ohr liehen, könnten diese LP durchaus besitzen, denn wie die
Gruppe QUILAPAYUN, wie MERCEDES SOSA, zählte Inti Illimani zur international
anerkannten Elite des politischen Liedes.
Im Gegensatz zu hiesigen Liedermachern wird der Südamerikaner selten plakativ
oder gar aggressiv; er liebt die Umschreibung. Mitunter - “wie die Katze
um den heißen Brei” - nähert er sich seiner beabsichtigten Aussage auf
Umwegen, um schließlich poetisch, bild- und gleichnishaft auf den Punkt
zu kommen. Mit dieser Tradition räumte Inti Illimani radikal auf und dürfte
damit bei den Liedermachern ihres Kontinentes beträchtliche Verwirrung
erzeugt haben. Die Unterdrückung des Volkes umschrieb Mercedes Sosa beispielsweise
mit “... soviel Winter im Gesicht meines letzten Bruders...”; Inti Illimani
schließt sich sinngemäß der italienischen Linken an, wenn es am Ende der
LP im politischen Schulterschluß mit der Gruppe Quilapayun heißt: “...
el Pueblo unido jamás será vencido!” (ein einiges Volk ist unbesiegbar).
Mit diesem Fanal erhält die Schallplatte einen zeitlos-gänsehäutigen Habitus,
der auch deshalb so heftig zugreift, weil ein auf andiner Folkloretradition
basierter Titel die Platte eröffnet, dem sukzessive sich steigernde Protestlieder
folgen. Da wird auch ein historischer Rückblick nicht vergessen: “Asi
como hoy matan negros” (Wie sie die Schwarzen mordeten), und man findet
zurück in die seinerzeitige Gegenwart: “Chile herido” (verwundetes Chile).
All’ das, all’ diese sich in die innerste Empfindung hineinfressenden
Aussagen, Vorwürfe und Schreie der Unterdrückten, finden ihren musikalischen
Ausdruck durch den Einsatz vieler traditioneller, andiner Instrumente;
die Texte schließlich stammen von den größten Dichtern des Kontinents:
Namen wie Violetta Parra, Victor Jara, Pablo Neruda und Sergio Ortega
bedürfen keiner weitschweifigen Erklärung...
Das politische Lied als Weltmusik - dieses Kunstwerk hat die chilenische
Gruppe Inti Illimani der Nachwelt hinterlassen; und es braucht keine speziellen
Kenntnisse um festzustellen, daß die Aussagen an Aktualität nichts eingebüßt
haben, befindet sich die Welt doch scheinbar unaufhaltsam auf dem Weg
zur kybernetischen, menschenverachtenden Globalität: Geld ist alles, das
Individuum gerät immer mehr in den Zustand der Unwichtigkeit...
2) TE VAKA:
Pazifische Musik von der Insel Tokelau
CD, EUCD 1401, ARC-Musik, HH
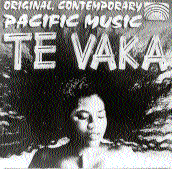 Eigentlich
möchte ich diese ungewöhnliche Musik als polynesisch bezeichnen; ohne
Zweifel hat sie in diesem Kulturkreis ihre Wurzeln. Allerdings bietet
das Programm der vorliegenden CD nicht, wie man vielleicht erwarten würde,
Folklore, sondern komponierte Werke. Der Titel entspricht dem Namen der
hier aufspielenden Gruppe: TE VAKA, ein Wort der polynesischen Sprache,
bedeutet “Das Kanu”. Te Vaka besteht aus zehn Künstlern, welche unter
der Leitung ihres in Samoa geborenen Sängers und Texters Opetaia Foa’i
in hinreißender Form die Musik aus dem Gebiet von Neuseeland darbieten,
genauer gesagt: Die Musik der nahe Neuseeland gelegenen Insel Tokelau.
Starke Einflüsse aus dem polynesischen Raum sowie Australien sind unüberhörbar
und zeigen sich nicht zuletzt im erklingenden Instrumentarium: Te Vaka
spielt gleichermaßen auf traditionellen wie auch modernen Instrumenten,
wobei natürlich die alten Bauformen - zumindest aus meiner Sicht der Dinge
- den größeren Reiz besitzen.
Eigentlich
möchte ich diese ungewöhnliche Musik als polynesisch bezeichnen; ohne
Zweifel hat sie in diesem Kulturkreis ihre Wurzeln. Allerdings bietet
das Programm der vorliegenden CD nicht, wie man vielleicht erwarten würde,
Folklore, sondern komponierte Werke. Der Titel entspricht dem Namen der
hier aufspielenden Gruppe: TE VAKA, ein Wort der polynesischen Sprache,
bedeutet “Das Kanu”. Te Vaka besteht aus zehn Künstlern, welche unter
der Leitung ihres in Samoa geborenen Sängers und Texters Opetaia Foa’i
in hinreißender Form die Musik aus dem Gebiet von Neuseeland darbieten,
genauer gesagt: Die Musik der nahe Neuseeland gelegenen Insel Tokelau.
Starke Einflüsse aus dem polynesischen Raum sowie Australien sind unüberhörbar
und zeigen sich nicht zuletzt im erklingenden Instrumentarium: Te Vaka
spielt gleichermaßen auf traditionellen wie auch modernen Instrumenten,
wobei natürlich die alten Bauformen - zumindest aus meiner Sicht der Dinge
- den größeren Reiz besitzen.
Sie hören auf dieser CD die Baumtrommel “Pate”; sie wird aus dem Puapua-
oder Fetau-Baum hergestellt und ist ursprünglich ein Signal- bzw. Nachrichteninstrument.
Daraus geht hervor, daß die “Pate” erhebliche Schallenergie abstrahlt.
Es erklingen Congas und Baßtrommeln, die in früherer Zeit aus “Pa’u mago”
(Haifischhaut) gefertigt wurden; heutigentags bestehen sie aus Ziegen-
oder Rinderhaut.
Außerdem hören wir eine Holzflöte, die aus dem schwarzen Maire-Holz in
Neuseeland in Handarbeit gemacht wird. Sie klingt voll und singend, strahlt
wahrhaft exotisches Flair aus.
Den vorerwähnten Einfluß Australiens unterstreicht das “Didgeridoo”, ein
traditionelles, großvolumiges Blasinstrument der australischen Ureinwohner
(Aborigines), welches ebenfalls aus Maire-Holz besteht und auch in Neuseeland
hergestellt wird.
Die Gitarre darf natürlich nicht fehlen - wohl kaum ein anderes Instrument
ist international derart beliebt und verbreitet. Sie wurde u.a. in Tokelau
von den Walfängern im 19. Jahrhundert eingeführt und begleitet alle Stücke
auf dieser CD. Auffällig ist ihr ungewöhnlicher Klang, was aus der typischen
Stimmung herrührt, die sich auf den pazifischen Inseln entwickelte.
Dieses äußerst interessante Instrumentarium realisiert ein Klangbild,
das zwar vollkommen fremd ist, dennoch - im Gegensatz zu diversen anderen
- gleich ins Ohr geht, binnen kurzem vertraut und ansprechend wirkt. Maßgeblichen
Anteil hieran haben die oft schlicht und ergreifend schönen, melodischen
Rhythmen - und beinahe noch größeren Anteil bringen die berückenden Stimmen
der Künstler ein, wenn sie in der wundervollen, melodiösen Sprache der
polynesischen Inseln ihre Lieder vortragen. Mein persönlicher “Hit” ist
“Te Namo” (Titel 2): Te Namo bedeutet “die Lagune” und besingt eben eine
Lagune, in der die Kinder gefahrlos spielen können. Die oben genannte
Maire-Flöte bringt tonale Akzente, und im zweiten Teil des Liedes setzt
ein Kinderchor ein - mit diesen einzigartigen, samtweichen Stimmen, der
ungemein klangschönen, ausdrucksvollen Sprache... Ich kann mir nicht vorstellen,
daß irgendjemand da gleichgültig bleibt... Die Musik ist Ausdruck uralter
Kultur, strahlt Frieden und Zuversicht aus, nimmt den Hörer in ihre Welt
hinein.
Doch geht es beileibe nicht immer nur “schön” zu auf dieser CD, nein:
Te Vaka berichtet auch von der dramatischen Geschichte des Volkes von
Tokelau. Wie ich bereits im Heft 30 anmerkte, wurde die Insel im 19. Jahrhundert
durch Sklavenjäger bis auf 80 Verbliebene entvölkert. Das menschliche
Elend, die unbändige Trauer - welche Worte wären geeignet, das zu verdeutlichen?!
Also versuche ich es gar nicht erst, überlasse dies der Gruppe Te Vaka,
die mit den Titeln 7 (Vaka gaoi - das Sklavenschiff) und kontextlich anbindend
Titel 8 (Tagi Sina - Sina weint) eine Darstellung der Geschehnisse gibt,
welche den Hörer machtvoll in die Szenerie hineinzieht. Dazu braucht man
die polynesische Sprache gar nicht zu verstehen - das Wissen um die grausame
Geschichte reicht völlig. Im take 7 hört man, untermalt von Trommeln,
den stoßweisen Atem eines fliehenden Menschen... mit einem Donnerschlag
bricht der Titel plötzlich ab - und es folgt “Tagi Sina”:
Tagi Sina
Ko kalalaga tuku mai te vaka e
Sina weint
Sie schreit: Bitte bring’ das Boot zurück
Für “Boot” setze man “Sklavenschiff” - die Art des Vortrages macht auch
harte Burschen ganz schön fertig...
Die typische Fröhlichkeit der Polynesier ließ die schrecklichen Vorgänge
zwar nicht in Vergessenheit geraten, doch das Leben geht dort wie überall
weiter; und so wird in den anderen Liedern vom Leben auf Tokelau gesungen,
vom guten Fischer, von der Entdeckung der Insel, den Rollen von Mann und
Frau in der Gesellschaft, vom Mann, der am Strand liegend von einem leckeren
Fisch träumt und schlußendlich heißt es im Titel 12 “Siva mai” - laßt
uns tanzen. Hier hat Songtexter Opetaia Foa’i den drei Inseln Tokelau,
Tovalu und Samoa in Form einer musikalischen Hommage ein tönendes Denkmal
gesetzt.
Die CD, auf Tokelau aufgenommen, bietet ein volles, weiträumiges Klangbild
von großer Dynamik in Verbindung mit sauberer Detailzeichnung. Schwächliche
Tieftöner dürften von der Baumtrommel überfordert werden. Berückende Stimmen,
ungewöhnliche, fremde, doch so vertraute Musik... ich möchte fast sagen:
Dieser Tonträger nimmt Sie mit auf eine Reise in die Südsee...
3) FOLKLORE DER
ANDEN
mit den Gruppen “Ichu”,
“Ichumanta”, “Inti Punchai”
und “Inti Mujus”
BELL BLR 89024 (CD)
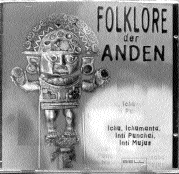 Im
“Merkheft” des 2001-Versand, unter einer Rubrik in der Art von “haufenweise
Niedrigpreise”, fand ich diese CD zum Preis von 9,95 DM! Da kann man nichts
falsch machen und ich erwartete - ja, was eigentlich? Der Titel strotzt
nicht gerade vor Einfallsreichtum... ‘schauen wir ‘mal’, dachte ich. Als
ich die CD nach einiger Zeit in Händen hielt, traute ich meinen Augen
nicht: Die o.g. berühmten Gruppen, Laufzeit 69:40 und - Digitalmastering
von TACET! Mit einiger Erwartungshaltung startete ich den Player - und
erlebte eine der ganz seltenen positiven Überraschungen: Durchweg vorzügliche,
weiträumige Tontechnik (lediglich take 18 fällt geringfügig ab), wunderschöne
Klangzeichnung, erstklassige Interpretationen und: Weltmusik im Sinne
des Wortes!
Im
“Merkheft” des 2001-Versand, unter einer Rubrik in der Art von “haufenweise
Niedrigpreise”, fand ich diese CD zum Preis von 9,95 DM! Da kann man nichts
falsch machen und ich erwartete - ja, was eigentlich? Der Titel strotzt
nicht gerade vor Einfallsreichtum... ‘schauen wir ‘mal’, dachte ich. Als
ich die CD nach einiger Zeit in Händen hielt, traute ich meinen Augen
nicht: Die o.g. berühmten Gruppen, Laufzeit 69:40 und - Digitalmastering
von TACET! Mit einiger Erwartungshaltung startete ich den Player - und
erlebte eine der ganz seltenen positiven Überraschungen: Durchweg vorzügliche,
weiträumige Tontechnik (lediglich take 18 fällt geringfügig ab), wunderschöne
Klangzeichnung, erstklassige Interpretationen und: Weltmusik im Sinne
des Wortes!
Unmöglich, alle zwanzig Titel en detail vorstellen und erläutern zu wollen:
Es wird eine derart große Spannweite geboten, daß man diese CD mit Fug
und Recht als “das” Beweisstück für die Weltläufigkeit der südamerikanischen
Musik bezeichnen darf. Von typisch bolivianischer Folklore geht es über
schwarzafrikanisch Basiertes hin zum Fischer (pescador) auf dem “lago
sagrado” (Heiliger See = Titi Caca See; korrekte Schreibung ist “Titi
Qaqa Qocha”); es erklingen die ethnomusikologisch perfekt dargebotenen
Titel “Leyenda de la Kantuta” und “Acuarela Indigena”; die Musik führt
uns durch Perú und Ecuador nach Venezuela, wo bei einem Fest “der Teufel
los ist” (“El Diablo Anda Suelto”); Inti Punchai liefert die endgültige
Interpretation des alten, andinen Liedes “Huayayay” und packt zumindest
den kundigen Hörer mit dem hochdramatischen Werk “Tema de la Mina”.
Tema de la Mina - die Vokabel “tema” bedeutet “Thema”; “Aufgabe”. Wegen
der Vorliebe südamerikanischer Texter für Umschreibungen scheint mir die
weitgefaßte Titelübersetzung “unser Thema sind die Geschehnisse in der
Mine” zutreffend. Hier wird mit musikalischen Mitteln eine Geschichte
erzählt, zu der ich eine durchaus andere Meinung vertrete als der fachkundige
Booklet-Autor, welcher den Inhalt des Liedes wie folgt erläutert (Zitat):
“... in ihrem Stück spiegeln der helle Klang der Quenas sowie die Begleitung
durch Charango, Gitarre und Wankara die Ruhe und Abgeschiedenheit der
Andenlandschaft ... lassen die Einsamkeit ahnen, in der einst die Minenarbeiter
lebten, bevor jauchzende Quenas, der anschwellende Gesang näherkommender
Menschen und die voluminösen Töne der Toyos die glücklichen Momente in
dem kargen Leben symbolisieren.”
Zunächst: Man sollte sich bei Begriffen der Quechua-Sprache definitiv
auf eine Schreibweise festlegen, nämlich die spanische Orthographie (dann
hieße es nicht “Wankara” sondern “Huancara”), oder aber (besser) das “Alfabeto
Oficial” verwenden - dann schreibt man nicht “Quena”, sondern “Kena”.
Und der Plural darf keineswegs mit einem /s/ gebildet werden (“kena/s/”)!
Entweder (Plural) “die Kena”, oder (Plural des Quechua) “kenakuna”. Es
heißt auch nicht “die Inka/s/”, sondern entweder “die Inka” oder (Plural
des Quechua) “Inkakuna” etc.
Wie angedeutet, sehe ich den Sachverhalt hinsichtlich der Aussage des
Werkes von gänzlich verschiedener Warte; anderen Wissenschaftsgebieten
vergleichbar, gibt es auch in der Sprachwissenschaft (hier: Quechua) und
der Altamerikanistik das, was man Hermeneutik nennt. Nach meiner Kenntnis
der Dinge - Schwerpunkt: Quechua-Sprache sowie Kulturen und Religionen
der Hochlandindianer - wird weder die Einsamkeit der Cordillere beschrieben,
noch die Kargheit des Lebens; da kommen keine Menschen zusammen und es
jubilieren auch keine Flöten zu einem Freudenfest. “Tema de la Mina” beschreibt
für mich eindeutig und ohne jeden Zweifel die inhumanen Vorgänge rund
um den Silberberg von Potosí: Als der erste Ansturm der Conquista (beginnend
am 16.11.1532) vergangen und aus einem autarken Reich eine ausgeplünderte
Provinz geworden war, kam die zweite Conquista: diesmal nicht in Form
militärischer Aktionen, sondern als Kapitalismus in seiner brutalsten
Form. Bei Potosí (Bolivien, damals “Alto Perú”) war 1545 jener Berg entdeckt
worden, der buchstäblich aus Silber bestand. Von 1570 bis 1630 stellte
Potosí über die Hälfte der weltweiten Silberproduktion. Im Einzugsgebiet
der Stadt, die 1611 bereits 160.000 Einwohner zählte, lebten etwa 100.000
Indianer - und um sie als minimal entlohnte Halbsklaven ausbeuten zu können,
erließ der Vizekönig 1574 ein Gesetz, das unter der Bezeichnung “Mita
de Minas” zur Arbeit in den Bergwerken verpflichtete. Die Minenarbeiter
von Potosí schufteten unter denkbar widrigsten Umständen, es gab zahllose
Tote und Verletzte - und die Überlebenden blieben arm wie zuvor. Unsägliche
Arbeitsbedingungen, verkommene Unterkünfte, schlechtes Essen - das alles
ist kaum ein Grund, die Flöten jubilieren zu lassen. Nein: Dieses Lied
zeigt uns, einem Breitwandfilm gleich, die verdrängten, vergessen gemachten
Vorgänge. Auf einer leicht angehauchten “siku” wird der ewige Wind des
Hochlandes dargestellt; unendliche Berge; die “kena” kennzeichnet das
Leben der indianischen Arbeiter - und im Hintergrund ruft eine verzweifelte
Stimme: “Es la tierra de la Pachamama!” (“Das ist das Land der Erdgöttin!”,
was impliziert: Das, was ihr da tut - das dürft ihr nicht! Ihr stehlt
das Eigentum der Göttin und damit das Eigentum aller!) Dies wird konterkariert
durch spanische Rhythmen, vorgetragen auf einer klassischen Gitarre. Und
immer wieder dieses “Streitgespräch” der Instrumente, bis die Gitarre
dominiert... da setzt ein sanfter Gesang ein (wayayay...), mit typisch
indianischer Onomatopoetik. Den Schluß bildet ein autoritäres Klanggemälde
der “Hatun Siku” (anderthalb Meter lange Panflöte), womit der Hoffnung
Ausdruck verliehen wird, daß indianisches Land dermaleinst wieder in indianischen
Besitz gelangt... Wie gesagt: Ein hochdramatisches Werk.
Diese CD habe ich in ihrer Gesamtheit analysiert wie kaum eine andere,
und es sei nicht verschwiegen, daß ich beim Übersetzen diverser Quechua-Titel
einmal heftig in die Bredouille geriet: take 12 heißt “Chirihuayrita”...
hmm... Erstmal ins Alfabeto Oficial transkribieren: “chiriwayrita” - schon
besser. Und jetzt: “chiri” bedeutet “kalt”... “wayri”...? Blume..., nein,
die heißt “wayta”. Dann die Erleuchtung: Das transitionale Suffix “-way”
kennzeichnet eine Handlung “von dir zu mir”... und das inchoative Suffix
“-ri” mit seinen vier Deutungsmöglichkeiten... ja, hier bezeichnet es,
daß ein Vorgang sich in seiner Anfangsphase befindet... Schließlich hatte
ich es: chiri-way-ri-ta. Wörtlich: kalt-du mir/mich-beginnen-können/wissen
zu tun... zu deutsch: “Du verstehst es, in mir Kälte zu erzeugen”. Mithin
der Abgesang auf eine Liebesbeziehung, die ein Indianer mit einer treulosen
“cholita” eingehen wollte. Schulterklopfmaschine ein!
So, genug der Arabesken. Was bleibt, ist: Diese CD möchte ich Ihnen mit
allem Nachdruck empfehlen, da sie auf selten intensive Weise nicht nur
die Musik der Anden in Ihrem Hörraum erklingen läßt, vielmehr stellt sie,
aufgrund der gegebenen Dokumentation der Internationalität südamerikanischer
Musik und ihres kulturellen, künstlerischen und ethnischen Synkretismus’,
eine wahrlich unverzichtbare Anschaffung dar.
Wie ich zwischenzeitlich erfuhr, ist “Folklore der Anden” auch in den
Tonträgerabteilungen großer Kaufhäuser erhältlich - ebenfalls zum eingangs
erwähnten Preis. Wenn Sie diese CD irgendwo finden: Kaufen!
WD